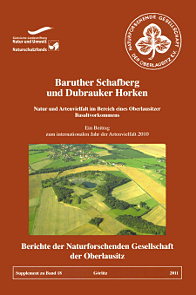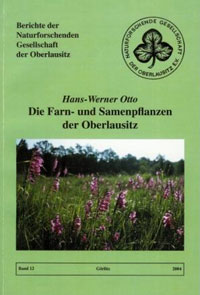|
Naturschutzkonzeption Landeskrone 1993 wurde für das NSG »Landeskrone« bei Görlitz ein Pflege- und Entwicklungskonzept erarbeitet. Auf dieser fachlichen Grundlage erfolgte 1999 eine Bestätigung des NSG |
Dokumentation »Das Dubringer Moor« Ende 1999 erschien eine umfassende Naturdokumentation zum größten Moorkomplex |
Publikation »Flora von Herrnhut und Umgebung« Die erneute Dokumentation des Gebietes ist inzwischen eine unersetzbare Grundlage |
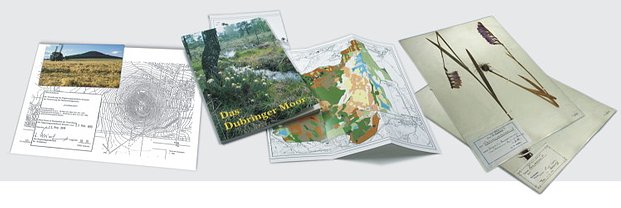 |
||
Entbuschung des Kesselmoores Sagoinza

Laufzeit: 26.4.2017 – 30.4.2019
Gefördert durch das SMUL nach der Förderrichtlinie Natürliche Erbe – RL NE/2014
Ziel des Projektes ist, den Verlust von moortypischen Arten und die endgültige Degeneration der Moorfläche zu verhindern. Dazu werden die Gehölze aus der Fläche entfernt, um den durch (Evapo-)Transpiration verursachten Wasserentzug aus der Fläche zu reduzieren und lichtanspruchsvolle Pflanzenarten zu fördern.
Im Rahmen des Projektes werden in den Winterhalbjahren 2017/2018 und 2018/2019 die Gehölze von der Fläche entfernt. Dies erfolgt ausschließlich manuell und die gesamte Biomasse, die bei der Entbuschung anfällt, wird von der Fläche abtransportiert.
Artenhilfsprogramm für vier gefährdete Pflanzenarten in Ostsachsen

Laufzeit: 31.3.2015 – 31.12.2019
gefördert durch das SMUL nach der Förderrichtlinie Natürliche Erbe – RL NE/2014
Ähnlich wie in dem abgeschlossenen Vorhaben der NfGOL e.V. „Vermehrung und Wiederansiedlung gefährdeter Pflanzenarten in der Oberlausitz“ werden in diesem Projekt bestandsunterstützende Maßnahmen für einst typische und nun sehr selten gewordene Pflanzenarten der Oberlausitz durchgeführt. Ziel des Vorhabens ist einerseits die Ex-situ-Vermehrung der Arten Arnica montana und Genista germanica aus gebietsheimischer Herkunft sowie die Ausbringung der Jungpflanzen auf geeigneten Flächen in der Oberlausitz. Andererseits wird durch das Umweltzentrum Dresden eine innovative In-vitro-Vermehrung der beiden Orchideenarten Orchis mascula und Dactylorhiza fuchsii durchgeführt. Innerhalb des Projektes werden mehrere Flächen ermittelt, die für eine spätere Auspflanzung der Orchideen geeignet sind und an denen eine langfristige Etablierung der Arten wahrscheinlich ist.
Edaphobase Länderstudie

Edaphobase ist ein taxonomisch-ökologisches Datenbanksystem, das vorhandene taxonomische Primärdaten zu Bodenorganismen aus Sammlungen, wissenschaftlicher Literatur und Berichten etc. zusammenführt. Das Besondere der Datenbank ist dabei die Verknüpfung mit ökologischen Hintergrundinformationen von den Fundorten der Bodentiere, die eine umfassende Aus- und Bewertung der Daten für komplexe ökologische Fragestellungen möglich macht. Mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) wurde die Datenbank am Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz von 2009 bis 2013 aufgebaut und ein großer Teil von Daten eingegeben.
In der zweiten Projektphase von Edaphobase (01.08.2013 – 31.07.2017, gefördert durch das BMBF) steht die Weiterentwicklung der Datenbank und insbesondere deren intensive Anwendung im Vordergrund.
|
Phrygische Flockenblume Die Phrygische oder Österreichische Flockenblume – Centaurea phrygia kommt in Deutschland exklusiv nur in der Oberlausitz vor und ist bundesweit vom Aussterben bedroht. Durch intensive Nutzung gehen die Vorkommen ohne geeignete Maßnahmen weiter zurück. Aufgabe des Projektes ist die Erfassung aller historischen und aktuellen Fundpunkte. Aus den Untersuchungen ergeben sich Maßnahmenvorschläge zum Erhalt und der Ausbreitung der Vorkommen. Es erfolgt im Auftrag des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. |
 |
|
|
|
|
Vermehrung und Wiederansiedlung gefährdeter Pflanzenarten in der Oberlausitz Laufzeit: 23.12.2012 – 30.06.2015 gefördert durch das SMUL Sachsen im Programm „Natürliches Erbe NE/A4“ Im umgesetzten Projektvorhaben wurden zehn Pflanzenarten des Offenlandes ausgewählt, die noch vor wenigen Jahrzehnten verbreitet und typisch für die Oberlausitz waren. Das Ausgangssaatgut stammte aus regionalen Wildvorkommen. Ansaaten und Jungpflanzenkultur erfolgten ex situ. Zudem wurden Erhaltungskulturen der Arten angelegt, von denen auch über die Projektlaufzeit hinaus Diasporen geerntet werden. Die Auspflanzungen erfolgten überwiegend auf landwirtschaftlichen Extensivflächen und künstlich geschaffenen Biotopen. |
Wiederangesiedelter Deutscher Ginster (Genista germanica) am neuen Schöpsverlauf bei Neuliebel. |
|
|
|
|
Baruther Schafberg und Dubrauker Horken Das mit nur einem Quadratkilometer sehr kleine Untersuchungsgebiet umfasst eines der nördlichsten Basaltvorkommen der Oberlausitz. Gesteinsuntergrund und anthropogene Einflüsse bilden die Voraussetzung für eine außerordentlich artenreiche Flora und Fauna mit zahlreichen geschützten Arten. Seit zwei Jahrhunderten wird hier geforscht, mit Abschluss der Arbeiten Ende 2010 sind von hier etwa 3600 Arten bekannt. An diesem Forschungsprojekt beteiligten sich mehr als 50 Mitarbeiter aus verschiedenen Fachbereichen der Gesellschaft. Der abschließende Bericht liegt seit April 2011 als Supplement zu Band 18 der Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz vor. |
 Foto: Peter-Ulrich Gläser |
|
|
|
|
Hohe Dubrau Der bis über 300 m Höhe aufragende Quarzitzug der Hohen Dubrau bildet die Grenze zwischen Hügelland und Oberlausitzer Tiefland. Die oberen Gipfelklippenrücken und der talwärtige Hangwald sind als Sonderschutzzone mit Traubeneichen-Buchenwald unterschiedlicher Vegetationstypen ausgewiesen. Der über 100-jährige Wald entstand durch Niederwaldbewirtschaftung und ist daher auch waldgeschichtlich wertvoll. Der Abschlussbericht ist 2008 in Band 16 der Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz, S. 121-136 veröffentlicht worden. Die Ergebnisse sind auch in das neue Handbuch "Naturschutzgebiete in Sachsen" (2010) eingeflossen. |
 Foto: Christian Klouda |
|
|
|
|
Lausche Die Lausche, ein Vulkankegel des Zittauer Sandsteingebirges und Grenzberg zu Böhmen, ist mit 792 m der höchste Berg der Oberlausitz. Die Untersuchungsfläche auf deutschem Boden ist ein naturgeschützter Buchenmischwald mit vielen, z.T. seltenen Pflanzen- und Tierarten, die für Mittelgebirge typisch sind. Moosreiche Blockhalden sind von besonderem Interesse. Erforschung und Schutz der Naturbestände werden von deutscher und tschechischer Seite gemeinsam betrieben. Die Ergebnisse des Forschungsprojektes sind in einem Fachartikel in Band 10 der Berichte der Naturforschendesn Gesellschaft der Oberlausitz (2002) und 7 Fachartikeln in Band 13 der Berichte (2005) erschienen. In das 2010 erschienene Handbuch "Naturschutzgebiete in Sachsen" sind ebenfalls Resultate des Projektes eingeflossen.
|
 Foto: Olaf Tietz |
|
|
|
|
Publikation „Die Farn- und Samenpflanzen der Oberlausitz“ Im Jahre 1955 war von M. Militzer und E. Glotz eine Flora der Oberlausitz abgeschlossen worden, die E. Barber im Jahre 1898 begonnen hatte. Die in den einzelnen Teilen behandelten systematischen Gruppen wiesen einen recht uneinheitlicher Bearbeitungsstand auf, viele Verbreitungsangaben entsprachen seit langem nicht mehr dem aktuellen Stand. Durch die im Jahre 2004 erschienene neue Oberlausitzflora wurden diese Mängel behoben: |
|